So Tun Als Ob
Die neue LP von Textor. Erscheint am 5. April 2024.
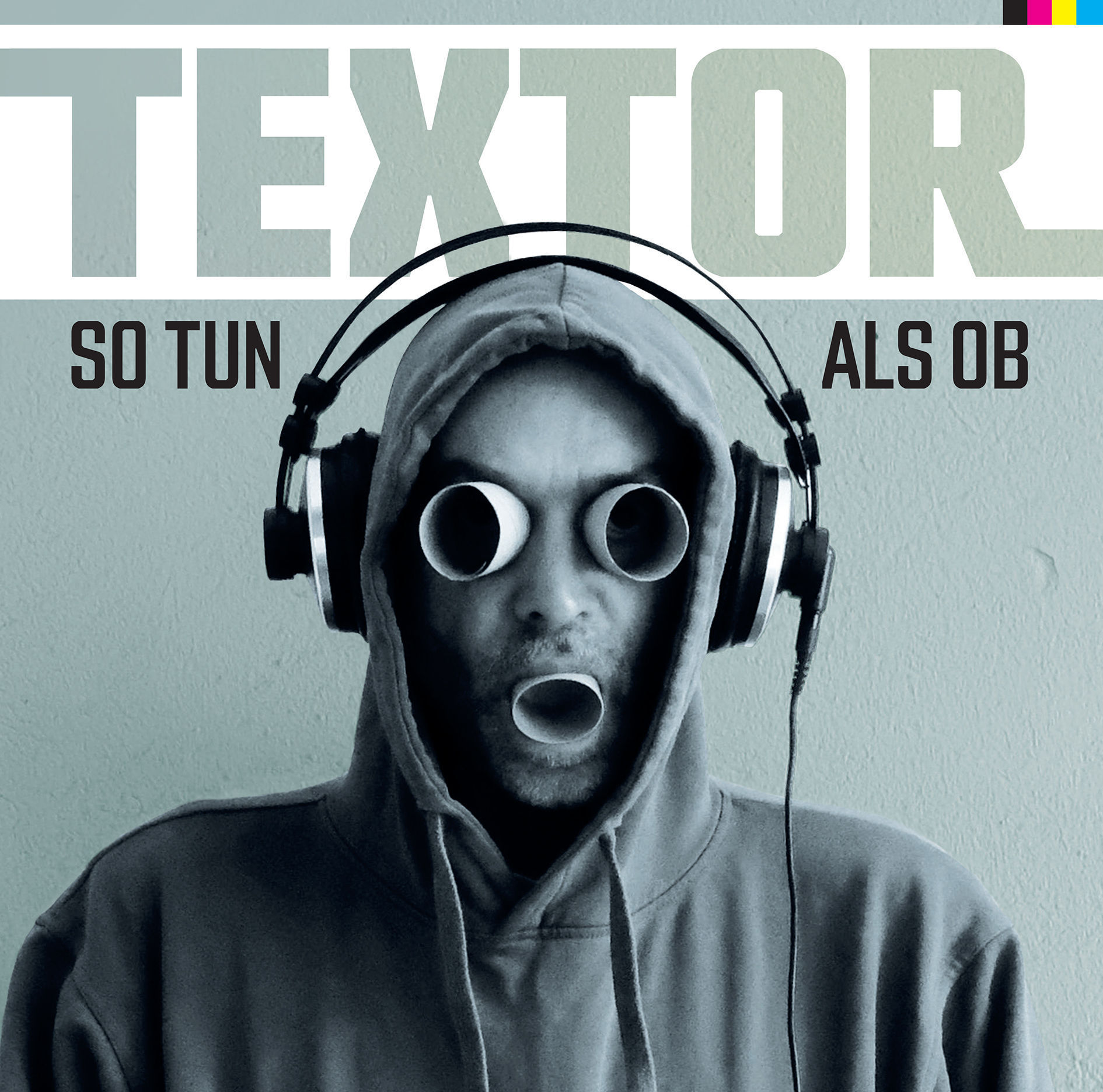
Textor live:
4.5. Hamburg Westwerk
31.5 Ulm, Kradhalle
1.6. Ulm Aegis Café (Lesung)
Die neue LP von Textor. Erscheint am 5. April 2024.
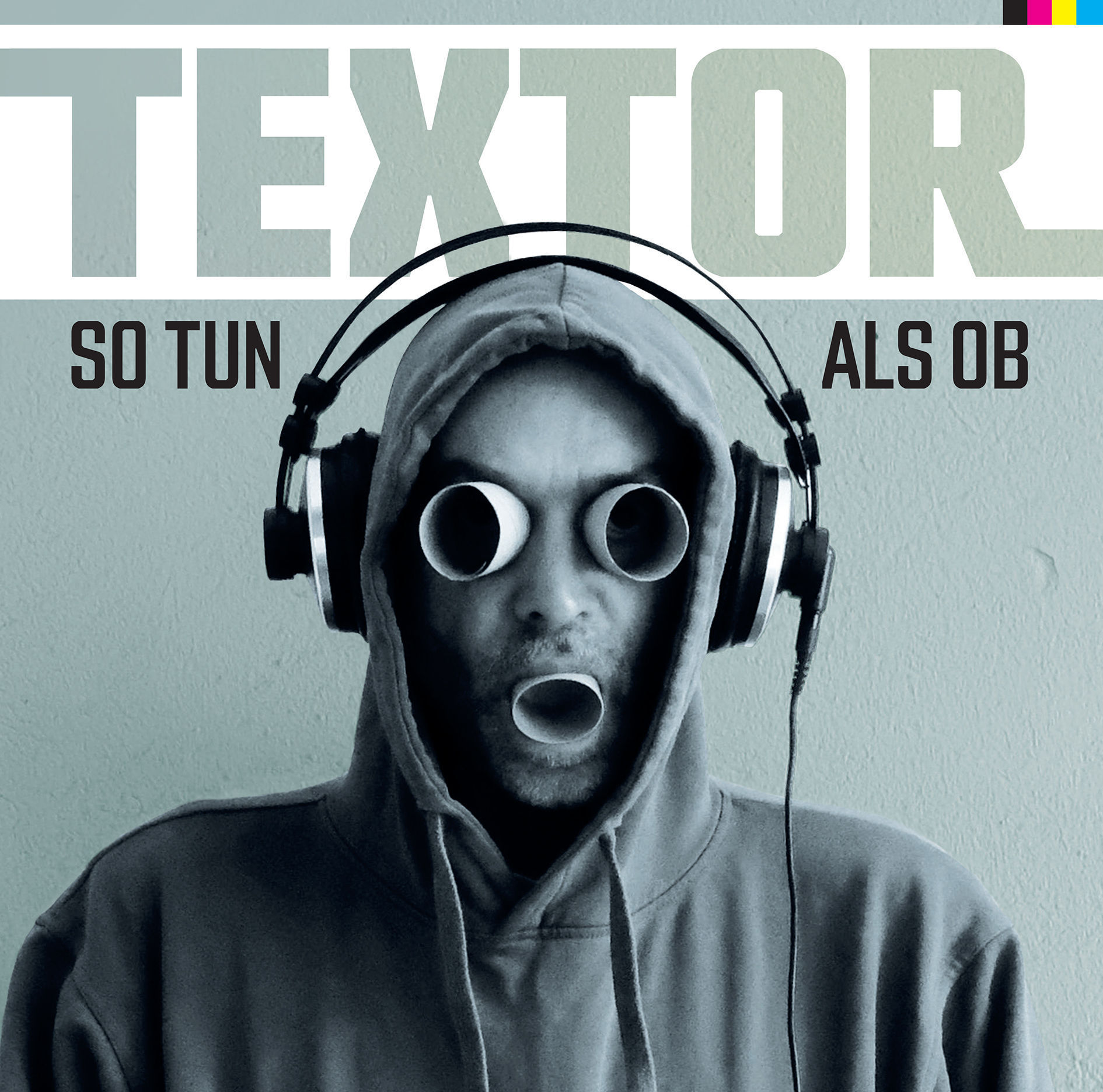
Textor live:
4.5. Hamburg Westwerk
31.5 Ulm, Kradhalle
1.6. Ulm Aegis Café (Lesung)